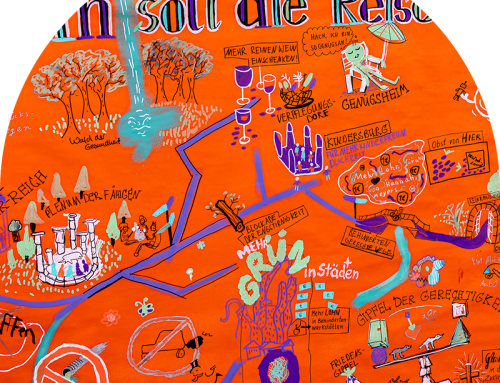35 Jahre nach der Wiedervereinigung prägen die tiefgreifenden Veränderungen in Ostdeutschland bis heute politische Haltungen, gesellschaftliche Debatten und persönliche Biografien. Am 25. September 2025 widmete sich eine Fortbildungsveranstaltung für Thüringer Lehrkräfte im Eiermann-Bau in Apolda dem Transformationsprozess und ostdeutschen Identitäten. Im Fokus stand die Transformationszeit in Ostdeutschland als umkämpftes Erinnerungsfeld. Die Frage „Wessen Geschichte wird erzählt – und wie?“ stellt sich aktuell auch vor dem Hintergrund der Aufnahme des Themas „Transformation seit 1989/90“ in die neuen Thüringer Geschichtslehrpläne.
Die Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung, des Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien und des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation fragte nach dominanten Narrativen, nach blinden Flecken im gesamtdeutschen Gedächtnis und nach den Chancen eines Dialogs über Herkunft, Identität und Zugehörigkeit.
Nach Keynotes von Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Kathrin Klausmeier von der Georg-August-Universität Göttingen wurden einzelne Aspekte in vier Workshops vertieft. Das Angebot des Zukunftszentrums fragte unter dem Titel „Ostblick – Westblick?“ nach der Medienmacht und der Deutungshoheit in der Transformationszeit.
Der Workshop wurde von Dr. Jan Schönfelder geleitet. Der Historiker und Journalist im Gespräch über die Vermittlung von Medienkompetenz, Berichterstattung aus kleinen Orten und seinen eigenen Blick auf 1989/1990 und die Folgen.

Historiker und Journalist Dr. Jan Schönfelder leitete den Workshop „Ostblick – Westblick?“
?—·→! Herr Dr. Schönfelder, beginnen wir mit einer Kinderfrage: Was ist der Hauptunterschied zwischen dem Mediensystem der DDR und der heutigen Medienlandschaft in Deutschland?
Dr. Jan Schönfelder: In der DDR wurden die Medien vom Staat beziehungsweise der Partei gelenkt und es gab keine unabhängige Berichterstattung. Heutzutage gibt es eine freie Presse und freie Medien. Die Medienlandschaft ist zudem vielfältiger und auch verführerischer. Menschen verschwenden heute durch die Nutzung von Medien sehr viel Zeit, manche verlieren sich regelrecht in den sozialen Medien. Heute kann man sich auf TikTok stundenlang Videos anschauen. Die DDR-Tageszeitung „Junge Welt“ war irgendwann ausgelesen.
?—·→! Sie arbeiten selbst als Journalist. Wie entscheiden Redaktionen, welche Geschichten über die DDR und die Transformation nach 1989/1990 erzählt werden?
Dr. Jan Schönfelder: Jahrestage wie der 13. August, der 3. Oktober und der 9. November sind natürlich immer ein Anlass, zum Thema zu berichten. Ich arbeite beim MDR. Dort gab es vor ein paar Jahren die Serie „Aufbruch ins Ungewisse“. Wir haben damals bewusst in die Provinz geschaut und nach unerzählten Geschichten gesucht. Ich habe mich zum Beispiel mit der ersten Demonstration am 7. Oktober 1989 in Thüringen beschäftigt. Die hat in Arnstadt stattgefunden. Ich bin Historiker und erzähle auch gern Geschichten, die bisherige Perspektiven und Wahrheiten in Frage stellen.
?—·→! Haben Sie ein Beispiel?
Dr. Jan Schönfelder: Viele kennen die Fluchtgeschichte von Peter Fechter und die Bilder, wie er nach seinem gescheiterten Fluchtversuch am 17. August 1962 tot im Mauerstreifen liegt. Ein symbolisches Bild für das mörderische Regime. Jedes Jahr wird in Berlin an ihn erinnert und auch die Springer-Presse berichtete ausführlich. Was kaum jemand weiß: Er ist damals nicht alleine geflüchtet. Sein Kumpel Helmut hatte es geschafft, unverletzt in West-Berlin anzukommen. Ich habe ihn vor zehn Jahren in Berlin besucht, ich weiß nicht ob er noch lebt. Damals hat er in einem Obdachlosenheim in Berlin-Marzahn gelebt. Eine völlig gescheiterte Existenz, Alkoholiker. Dieses Bild passt offenbar nicht zu Fechter, der die Freiheit wollte und erschossen wurde.
?—·→! Wenn wir auf die letzten 35 Jahre schauen: Wie haben die Medien seit 1989/1990 über die Transformation berichtet? Können Sie da Tendenzen festmachen?
Dr. Jan Schönfelder: Jenseits der genannten Jahrestage wird von den überregionalen, westdeutschen Medien meist nur dann über den Osten berichtet, wenn etwas Auffälliges passiert. Und meistens sind es die negativen Dinge, die auffällig sind. Anlässlich der Landtagswahl im letzten Jahr kamen alle Medien für das Wahlwochenende nach Thüringen, teilweise auch aus dem Ausland. Am Montag nach der Wahl fuhren dann alle in das Dorf mit dem höchsten AfD-Anteil. Da treffen sich Journalisten dort, wo noch nie jemand gewesen ist und wo auch nie wieder jemand hinkommen wird. Und die Einwohner im Dorf sagen: Da kam eine Pressemeute und hat uns als Nazi-Dorf dargestellt. Aber kein Medium nimmt sich die Zeit, genauer hinzuschauen: Was bedrückt die Leute vor Ort? Wer sind die Wortführer im Dorf? Welche Vereinsstrukturen gibt es? Gibt es eine aktive Kirchgemeinde? Was sagt die Pfarrerin dazu?
?—·→! Sie plädieren für umfassende und kenntnisreiche Recherche. Wie können Medien noch zur Wiedervereinigung beitragen?
Dr. Jan Schönfelder: Durch die Themensetzung! Nehmen wir das Beispiel Nachrufe: Als der Modefotograf F.C. Gundlach im Juli 2021 verstarb, brachte die Tagesschau einen zweiminütigen Nachruf. Als Herbert Köfer am Tag darauf starb, berichtete die Tagesschau nicht, obwohl viele Menschen im Osten ihn kennen. Er war bekannt aus dem Theater und dem Film, ein richtiger Volksschauspieler. Er gilt sogar als der erste Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen. Die Tagesschau ignorierte seinen Tod und er bekam nicht mal eine Wortmeldung. Die Tagesschau hat den Anspruch für ganz Deutschland zu senden und daher hätte Köfer dort zumindest erwähnt werden müssen.
?—·→! Wie können Lehrerinnen und Lehrer die Komplexität der Medien und der redaktionellen Entscheidungen, gerade in Hinblick auf die Transformation nach 1989/1990, im Unterricht vermitteln?
Dr. Jan Schönfelder: Das Mediensystem ist inzwischen so vielfältig! Als ich Schüler war, sprachen wir am Montag noch über die „Wetten das…?“-Sendung vom Samstagabend. In nicht-linearen Netflix-Zeiten gibt es heute kein Lagerfeuer mehr. Jeder schaut etwas anderes und nutzt Medien anders. Die eine schaut die Tagesschau bei YouTube, der andere in der ARD Mediathek. Das Schwierige ist, auch in der Vermittlung von Medien einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ein guter Ansatz sind sicher die Qualitätsstandards, darüber zu sprechen, was eine Nachricht und einen Kommentar unterscheidet, was Fakt und was Meinung ist. Diese kritische Mediennutzung können Lehrende mit ihren Schülerinnen und Schülern trainieren: Ist es seriös? Kann ich das teilen? Wo sind Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien? Was unterscheidet einen YouTuber von einer Influencerin? Das ist eine große Herausforderung, auch weil die Plattformen sich so schnell ändern.
?—·→! Können Schülerinnen und Schüler auch selbst aktiv werden?
Dr. Jan Schönfelder: Unbedingt! Gerade zum Thema Transformation. Ich sage nur: „Grabe, wo du stehst!“ Schülerinnen und Schüler müssen nicht die Geschichte des Mauerfalls erforschen und im Bundesarchiv recherchieren. Die Revolution hat nicht nur in Leipzig stattgefunden und die Grenzöffnung kam auch in kleineren Städten und Dörfern an. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Treuhand hat jeden Ort betroffen. Konsum-Verkaufsstätten wurden privatisiert, LPGs geschlossen oder umgewandelt. Es ist ja auch nicht alles gescheitert! Es gab auch Neugründungen! Plötzlich gab es überall Erotik-Shops! Beate Uhse hat die Kataloge vom LKW herunter verteilt, weil die Menschen sie unbedingt haben wollten. Diese lokalen Geschichten können von Schülerinnen und Schülern leicht ausgegraben und reflektiert werden.
?—·→! Wie haben Sie selbst das Jahr 1989 und die Folgen erlebt?
Dr. Jan Schönfelder: Ich war damals 14 Jahre alt und lebte in einer Kleinstadt in Thüringen. Ich wurde im Frühjahr 1989 konfirmiert und habe wie viele im gleichen Jahr auch Jugendweihe gemacht. Dann kam ich in die Junge Gemeinde meiner Kirchgemeinde. Im Sommer 1989 war da eine kleine Opposition aktiv. Im September gab es dann erste Friedensgebete und die Kirche war voll. Ich war hautnah dran, habe die Friedliche Revolution quasi aktiv beobachtet. Das hat mich geprägt.
?—·→! Wie blicken Sie auf die Zeit nach der Wiedervereinigung?
Dr. Jan Schönfelder: Natürlich sind viele Menschen entlassen worden, aber es gab auch Chancen, gerade für junge Menschen! Ich konnte Zivildienst leisten, Abitur machen, studieren, promovieren und ein Volontariat bei freien Medien absolvieren – alles Dinge, die ich in der DDR nicht hätte machen können. Ich sehe schon auch blühende Landschaften. Natürlich hatte Helmut Kohl eine Vision! Was sollte er den Leuten denn sagen? Ihr müsst alle durch das Tal der Tränen gehen? Was wäre das für ein Kanzler gewesen? Er kannte sein Land, er wusste, dass das zu schaffen ist und dass die BRD stark genug ist, um die marode Ex-DDR mitzutragen.
?—·→! Wie sind Sie zum Journalismus gekommen?
Dr. Jan Schönfelder: Zu DDR-Zeiten habe ich West-Radio gehört und West-Fernsehen geschaut. Seit 1990 dann die ganzen Politik-Magazine, Panorama und SPIEGEL TV. Während des Studiums habe ich erste journalistische Erfahrungen gesammelt. Ich habe Geschichte studiert und Geschichte und Journalismus passen gut zusammen. Im Studium habe ich gelernt zu recherchieren und viel gelesen. Ich wollte gern in Thüringen bleiben und von da berichten, wo ich herkomme und mich auskenne.
?—·→! Heute arbeiten Sie beim MDR. Diskutieren Sie in der Redaktion, welches Ost-Bild der Sender formt?
Dr. Jan Schönfelder: Ich arbeite im Landesfunkhaus in Erfurt. Für uns ist nicht der Osten die Referenz, sondern Thüringen. Wir sind regional verankert und Leipzig ist in dem Sinne weit weg. Wir überlegen immer: Was an diesem Thema ist für Menschen in Thüringen wichtig?
?—·→! Das heißt, wenn Sie eine Expertin für ein bestimmtes Thema suchen, schauen Sie, ob es jemanden in Thüringen gibt?
Dr. Jan Schönfelder: Genau, das ist der erste Blick. Und wenn es da niemanden gibt, schauen wir über den Tellerrand hinaus. Da ist es dann unerheblich, ob der- oder diejenige aus Mecklenburg-Vorpommern oder dem Saarland kommt. Die Kompetenz entscheidet. Beim Thema Wahlen fragen wir natürlich erst einmal an der Uni Jena oder Erfurt nach. Da ist es meistens so, dass die, die dort lehren, aus dem Westen kommen, aber schon viele Jahre in Thüringen leben. Da zählen Kompetenz und Wirkungsort, nicht die Herkunft.
—
Dr. Jan Schönfelder wurde 1975 in der DDR geboren. Er studierte Neuere Geschichte, Kunstgeschichte und Germanistische Literaturwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Magisterarbeit verfasste er zum Thema „Die Ökogruppe Knau/Dittersdorf. Fallstudie zu einer regionalen Protestbewegung in der DDR“. Seine Promotion erschien in Form von zwei Publikationen: „Kirche, Kerzen, Kommunisten. Die demokratische Revolution in Neustadt an der Orla 1989/90“ und „Aufbruch nach Deutschland. Politische Weichenstellungen in Neustadt an der Orla 1990-1994“. Seit 1999 arbeitet er beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) für TV, Radio und Online.